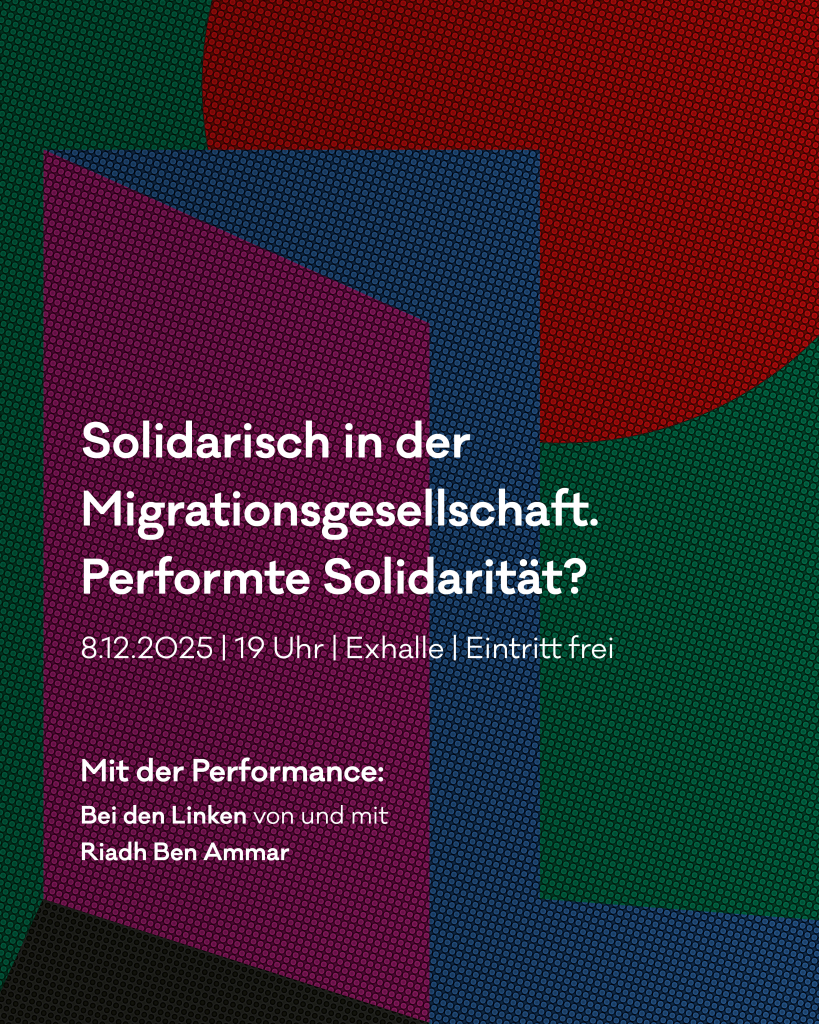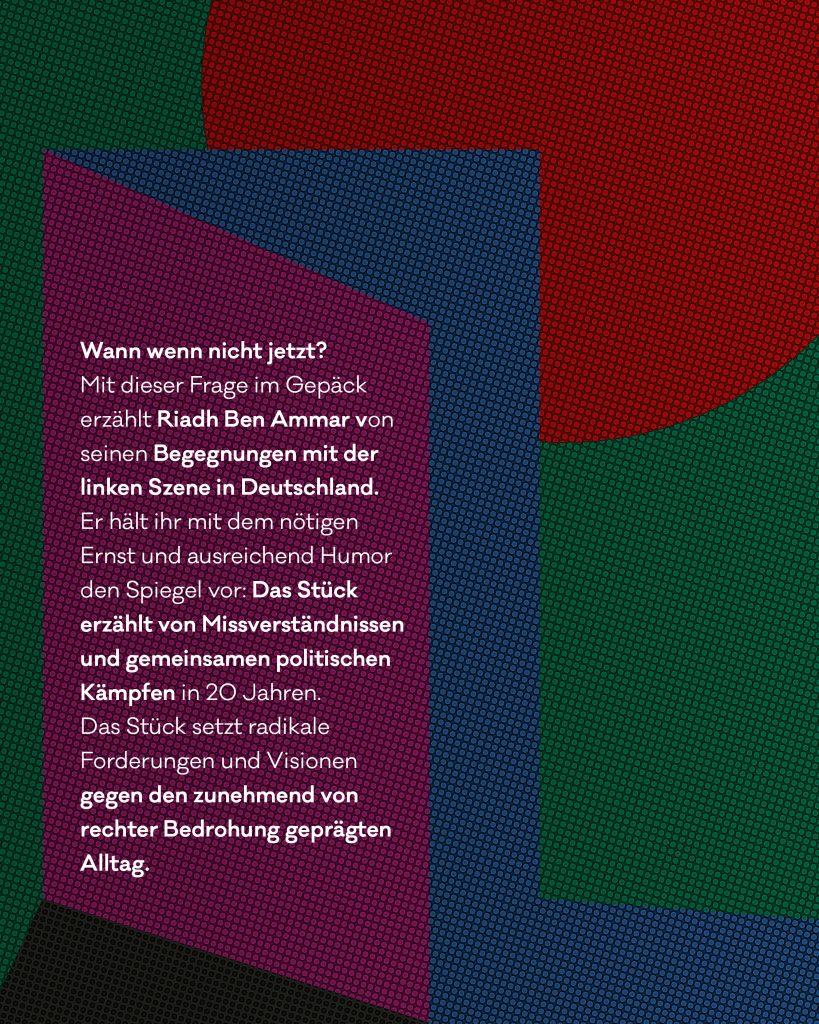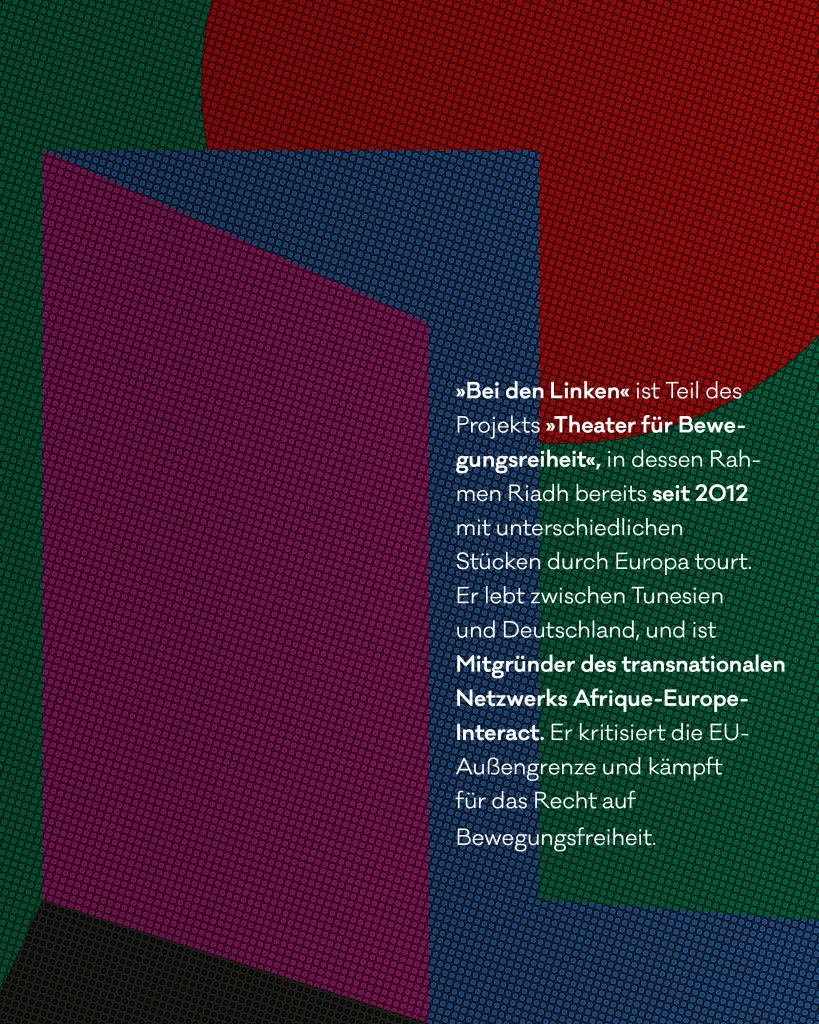Das Jahr 2026 hat gerade erst begonnen und schon jetzt darf sich Oldenburg auf hochkarätige musikalische Ankündigungen aus der Jazzszene freuen: Die Jazzmusiker Initiative Oldenburg setzt ihre Konzertreihe GEHÖRGÄNGE fort und lädt erneut zu zeitgenössischen Klangerkundungen ins Wilhelm13 ein. Dort präsentieren Musiker:innen ein vielfältiges Programm aus Jazz, Improvisierter Musik und Neuer Musik. Die Reihe besteht bereits seit 2012 und hat sich seither als fester Bestandteil des Oldenburger Musiklebens etabliert. Dabei sind die Konzerte bei der LANGEN NACHT DER MUSIK in Oldenburg und Bremen mit Beiträgen seit mehreren Jahren präsent. Wie bereits in den Vorjahren legt Hannes Clauss, Kurator der Reihe, in Zusammenarbeit mit dem HCL-Ensemble, großen Wert auf eine ausgewogene Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern. Clauss betont: „Das Besondere an dieser Reihe ist, dass wir dem Oldenburger Publikum die Möglichkeit bieten, Musik in den unterschiedlichsten Zusammenhängen zu hören.“
Genreübergreifend werden dabei auch Tänzer:innen, Schauspieler:innen und bildende Künstler:innen mit der Musik in Berührung gebracht. Im Mittelpunkt steht die Kunst der Improvisation: Nichts ist vorher abgesprochen, was ein hohes Maß an Können und Flexibilität von den Musikern und Musikerinnen erfordert. Clauss ergänzt: „Es gibt bei uns keine Tabus – vom Geräusch bis zur Melodie ist alles möglich, und das macht die Konzerte oft besonders spannend.“
Das erste Konzert der GEHÖRGÄNGE 2026 findet am 23. Januar statt. Den Auftakt des Programms 2026 gestaltet der Berliner Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Titus Selge mit einer besonderen Performance zum 100. Todestag Rainer Maria Rilkes. Im Zentrum stehen Rilkes Sonette an Orpheus, die vom HCL-Ensemble musikalisch begleitet und kommentiert werden. Wort und Musik treten dabei in einen dialogischen Austausch und eröffnen einen modernen Zugang zu Rilkes Werk.
Titus Selge, Neffe des Schauspielers Martin Selge, ist vor allem als Regisseur und Drehbuchautor für das Fernsehen tätig. Zu seinen Arbeiten zählen unter anderem Episoden der Reihen Polizeiruf 110 und Tatort.
Am 17. April ist der Saxofonist, Bandleader und Komponist Jan Klare bei den GEHÖRGÄNGEN zu Gast. Klare versteht seine künstlerische Praxis als „soziologische Feldforschung über Hörgewohnheiten, Hörerwartungen und deren Manipulation“. Das Konzert ist zweiteilig angelegt: In der ersten Hälfte präsentiert sich Jan Klare solo, bevor er in der zweiten Hälfte den freien improvisatorischen Dialog mit dem HCL-Ensemble sucht.
Am 4. September wird das Programm durch ein Konzert von Paul Hübner mit der Trompete fortgesetzt, der als Interpret, Komponist, Performer und Improvisationsmusiker tätig ist. Ein zentraler Fokus seiner Arbeit ist die intensive Zusammenarbeit mit Komponist:innen und Bühnenkünstler:innen zur Realisation neuer Werke für die Erforschung neuer Klänge – akustischer, inhaltlicher und sozialer Art – in eigenen Kompositionen und Improvisationen.
Dem HCL-Ensemble ist der kontinuierliche Austausch mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Neuen Musik ein besonderes Anliegen, da in dieser Zusammenarbeit sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten verschiedener musikalischer Konzepte sichtbar und hörbar werden. Im Zusammenspiel mit dem HCL-Ensemble sowie in einem Solobeitrag eröffnet sich dem Publikum die Möglichkeit, die Schnittstellen und Kontraste zwischen Improvisierter Musik und Neuer Musik unmittelbar zu erleben.
Den Abschluss der GEHÖRGÄNGE bildet am 20. November ein Abend mit der Oldenburger Künstlerin Patricia Borges De Medeiros. In einem Live-Setting projiziert sie mithilfe eines Overheadprojektors verschiedene Materialien, Farben und Zeichnungen und tritt dabei in einen unmittelbaren Dialog mit der Musik des HCL-Ensembles. Visuelle Elemente der Bildenden Kunst und das Akustische der Musik verschränken sich zu einem eigenständigen Hör- und Seherlebnis.
Mit ihrem vielfältigen Programm setzen die GEHÖRGÄNGE 2026 die langjährige Tradition der Reihe fort und bieten dem Oldenburger Publikum erneut spannende Perspektiven auf zeitgenössische Musik an der Schnittstelle von Jazz, Improvisation und Neuer Musik. Gleichzeitig lädt die Reihe dazu ein, etwas zunehmend Wichtiges zu üben: Unvoreingenommenheit beim Hören.
Tickets für die Reihe kann man auf der Website vom Wilhelm13 oder an der Abendkasse erwerben.
Veröffentlicht: MoX Veranstaltungsjournal. Januar 2026. (08.01.2026).